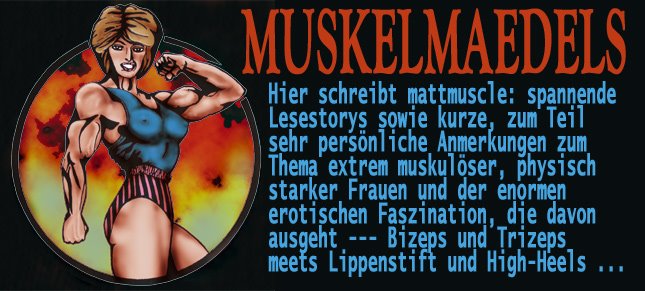|
| Titel der Erstausgabe von Arnoldis Roman |
Katie Arnoldi hat mit dem Roman "Chemical Pink" einen (in diverse Kultursprachen - nur nicht ins Deutsche - übersetzten) Roman geschrieben, der die Subkultur des Frauenbodybuilding und seiner Entourage unverblümt darstellt - dazu kann man an dieser Stelle bei Muskelmaedels.blogspot.de mehr lesen. Die Verfasserin weiß als ehemalige Wettkampfbodybuilderin, von was sie da geschrieben hat.
 |
| Katie Arnoldi in ihrer Bodybuilding-Zeit. |
Interessant aber auch, was Frau Arnoldi auf ihrer Website (oben, 2008 mit Autorenkollegen) zu dem ganzen Thema noch schreibt: "Die Welt der Physique-Wettkämpfe hat sich in den vergangenen zwanzig Jahren drastisch verändert. Chemical Pink spielt in den frühen 1990er Jahren, als Frauenbodybuilding eine relativ neue Sportart war. Frauen experimentierten immer noch mit Methoden, um Muskeln aufzubauen und ihre östrogenweichen Figuren in kompakt-muskulöse und fein gezeichnete Formen zu verwandeln. Zu der Zeit lautete der allgemeine Konsens "Je größer, desto besser". Es wurden viele Fehler gemacht, viele Frauen kamen zu Schaden als Ergebnis rücksichtslosen Experimentierens mit Steroiden, Wachstumshormonen, Insulin und anderen wachstumsfördernden Drogen. Heute sind die Sportarten Frauenbodybuilding/Physique/Fitness/Figure viel weiter ausdifferenziert. Lektionen wurden über das gelernt, was geht und was nicht. Was gut für Männer ist, ist nicht notwendigerweise richtig für Frauen."
 |
| Sportlich ist die Schriftstellerin wohl immer noch. |
Das heißt aber auch: Wenn der Film gemacht wird und in die Kinos kommt, wird er - sofern er da nicht von der Vorlage abweicht - den "technischen" Stand vom Beginn der 1990er Jahre spiegeln. Den aber werden viele - entgegen des oben zitierten Statements - für den Jetzt-Sachstand nehmen und es wird erneut alles am FBB ins Rampenlicht gezogen werden, was ihm schadet. Die Hingabe an diesen Sport, die (auch) sportliche Freude der Fans, das wird dann wieder hinten runter fallen.
 |
| Titel einer späteren Auflage - der gefällt mir zudem besser. |
Bedeutet das, was Katie Arnoldi gesagt hat, mit anderen Worten nicht auch, dass die in dem Buch (oben zwei verschiedene Titelversionen) beschriebenen Extreme in der Form nicht mehr existieren? Das Training hat sich doch verwissenschaftlicht, die Gabe von Zusatzstoffen aller Art ist demzufolge wohl sicherer geworden oder? Hm. Da sollte man sich nicht selber die Hucke volllügen. Die ein oder andere biochemische Nebenwirkung tritt nach wie vor auf, nicht nur als Spätschaden aus den 1980ern. Sei es bei einigen deutlich veränderten Gesichtern und der Körperbehaarung (siehe das in dem Kontext immer wieder internetweit gern gezeigte Foto unter diesem Abschnitt) sowie vor allem bei der allseits bekannten und in manchem Forum auch offen diskutierten Änderung im Intim-Bereich der Hardcore-Athletinnen - genau das bildet nämlich heute bereits einen eigenen Fetisch ...
Apropos Fetisch: Das Internet (und damit auch in sehr bescheidenem Maße dieser Blog) hat das Seine dazu beigetragen, dass diese Subkultur gewachsen ist - ich wage zu behaupten, dass sie das auch noch dauernd tut: Allein die Bilder- und Video-Menge nimmt permanent in einer Weise zu, von der ältere Fans wie ich in den 1980er und 1990er Jahren nicht zu träumen gewagt hätten: Schon meine entsprechenden Daten dürften quantitativ locker das übersteigen, was einst in sämtlichen Jahrgängen von Zeitschriften wie "Women's Physique World" zu finden gewesen ist. Auch wenn das Verhältnis zwischen Fans und Muskelmaedels immer noch unausgeglichen ist - jede der richtig starken Damen könnten, so sie wollte, sich ihren Begleiter aus einer ganzen Schar Anbeter heraussuchen. Und auch etwas anderes nimmt zu - es gibt zunehmend professionelle Liebesdienerinnen und Dominas mit zum Teil richtig wettkampfgerechten Muskelfiguren.
 |
| Titel eines anderen Romans von Katie Arnoldi - inzwischen hat sie drei Bücher verfasst. |
 |
| Louis Theroux traf für seine BBC-Doku auf FBB wie Linday Mulinazzi - und spielte prompt in dem Awefilms-Streifen "Gladiatrix" ein Opfer der starken rothaaarigen Amazone. |
 |
| Theroux gegen Tatianna --- keine Chance ... |
 | |
| L vs L = Lindsay gegen Louis - wer weiß, wie dieser Zweikampf ausgehen dürfte? |
Allerdings entstand diese Fernsehdokumentation schon im Sommer 2000 und erlebte ihre Erstausstrahlung im Oktober desselben Jahres. Damit scheint sie zumindest bei den ganz aktuellen Zusatzstoffsachen so überholt zu sein wie die in Katie Arnoldis Roman "Chemical Pink" geschilderten und - ich wiederhole - von ihr klar in den 1990er Jahren angesiedelten Umständen. Dass Louis Theroux ansonsten Verhaltensweisen und Ansichten herausgearbeitet hat, an denen sich seitdem im Grundsatz nichts geändert hat, das ist aber ebenso eindeutig.
 |
| Tatianna Butler - heute ist sie wieder gertenschlank und nicht mehr so imposant wie hier im Bild vor gut zehn Jahren. |
 |
| Aus meiner Fan-Sicht: wow!!! |
 |
| Die umwerfende Lindsay Mulinazzi - nach wie vor aktiv, quirlig, sehr muskulös, sehr sexy - letztgenanntes ist etwas, das sie sehr gekonnt inszeniert. |
 | |||
| Ein Muskelmaedel sieht zu, wie ihr ein Mann den stolz präsentierten, schwellenden Bizeps küsst - also, mir gefällt das nach wie vor! |